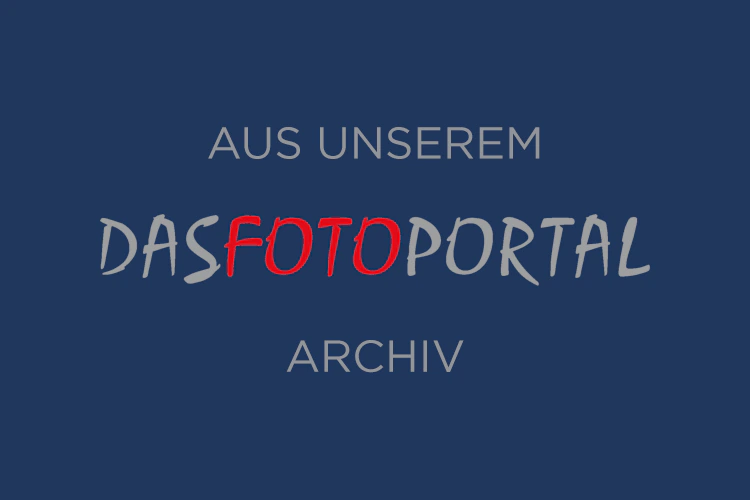An dem Tag, an dem die 5-Millionen-Spende von Zeiss an das Deutsche Museum offiziell bekanntgegeben wird, kommt noch ein weiteres bedeutendes Exponat von Zeiss dazu: eines der ersten Mikroskope, dessen Optiken vollständig auf Grundlage der Theorie der Bildentstehung im Mikroskop von Ernst Abbe berechnet wurden. Das Mikroskop „Stativ VIIb“ von 1879 wurde dem Deutschen Museum vom Deutschen Optischen Museum in Jena als Leihgabe überreicht. Es wird seinen Platz in der neuen Optik-Schatzkammer des Deutschen Museums finden, die gerade im Rahmen der Modernisierung des Hauses fertiggestellt wird. Es waren Mikroskope wie dieses, die den Weltruf des Unternehmens Zeiss begründeten. Carl Zeiss (1816 – 1888) hatte sein Unternehmen 1846 gegründet und begann schon im Jahr darauf mit der Produktion einfacher Mikroskope.
Mikroskop-Optiken wurden bis ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts auf Erfahrungsbasis gefertigt. Das damit verbundene Probieren schlug sich in einem eigenen Fachbegriff nieder: dem „Pröbeln“. Gute Hersteller gaben in ihren Firmenschriften bis in die 1870er an: „Besonders gut gelungene Objektive werden, soweit vorhanden, für entsprechend höhere Preise abgegeben.“
Carl Zeiss störte sich jedoch an dieser Ungewissheit und beschritt neue Wege – im Jahr 1866 nahm er die Zusammenarbeit mit dem etwa halb so alten Physiker Ernst Abbe (1840 – 1905) auf. „Ziel und Anspruch von Carl Zeiss war, seinen Kunden das zuverlässige Mikroskopieren mit den besten Optiken zu ermöglichen – und durch das theoretische Verständnis die Grenzen der Auflösung weiter voranzutreiben“, sagt Timo Mappes, Gründungsdirektor des Deutschen Optischen Museums.
Nach intensiven Arbeiten konnte Zeiss im Vorwort zu seinem Produktkatalog 1872 stolz vermerken: „Die hier aufgeführten Mikroskop-Systeme sind sämtlich neuerdings auf Grund theoretischer Berechnung des Herrn Professor Abbe in Jena konstruiert.“
„Den Hang zum Perfektionismus erkennt man noch an anderer Stelle: Seitdem die Objektive nach Abbes Berechnungen gefertigt wurden, versah Zeiss sie mit einer eigenen Seriennummer, die für den Benutzer unauffällig an der Fassung der Frontlinse angebracht wurde – so waren die Objektive stets vollständig rückverfolgbar“, sagt Mappes. Das Mikroskop „Stativ VIIb“, das das Deutsche Museum heute überreicht bekam, war besonders „für den Gebrauch in Laboratorien und für Lehranstalten geeignet“, jedoch mit einer derart präzisen Feineinstellung ausgestattet, dass noch die stärksten Objektive damit verwendbar waren.

Generaldirektor Wolfgang M. Heckl (rechts), Karl Lamprecht, Vorstandsvositzender von Zeiss Mitte) und
Timo Mappes, Gründungsdirektor des Deutschen Optischen Museums (links) , mit dem Zeiss-Mikroskop „Stativ VIIb“, das als neues Exponat in die Schatzkammer in die Ausstellung Klassische Optik kommt.
Und auch das neueste Mikroskop in der Sammlung des Deutschen Museums stammt von Zeiss – nämlich ein Rasterelektronenmikroskop, das für die Vorführungen im „Mikroskopischen Theater“ benutzt wird und das Besucherinnen und Besucher der neuen Optik-Ausstellung mit Einblicken in die Welt des Mikrokosmos faszinieren wird.
Die Physik-Ausstellung des Deutschen Museums bietet etwa 200 interaktive Experimente – eine wissenschaftliche Spielwiese, in der sich die Besucherinnen und Besucher mit physikalischen Phänomenen auseinandersetzen und nach dem Prinzip „learning by doing“ Zusammenhänge erkennen. können Basis der Ausstellung ist natürlich auch die einmalige Sammlung von rund 6000 Exponaten. Die Physik zählt zu den größten und wertvollsten Sammlungsbereichen des Deutschen Museums – sie umfasst herausragende Meilensteine der Wissenschaftsgeschichte, darunter Original-Instrumente von Physikern wie Heinrich Hertz, Otto von Guericke und Georg Simon Ohm und Nobelpreis-Exponate wie die Versuchsanordnung von Wilhelm Conrad Röntgen zur Entdeckung der Röntgenstrahlung. Rund 200 Exponate werden in der neuen Ausstellung Platz finden.
Das Museum hat immer schon das Ziel gehabt, junge Menschen für die Naturwissenschaften zu begeistern. Mit Erfolg. Der Physiker und spätere Nobelpreisträger Rudolf Mößbauer hat immer gern erzählt, dass sein Interesse an der Physik erst durch das Deutsche Museum geweckt wurde.